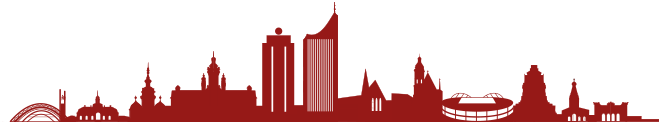Neues :: aus der Kanzlei
Nomos Handkommentar Arbeitsgerichtsgesetz
Die 3. Auflage des Hk-ArbGG befindet sich im Druck; für den 27.02.2025 kündigt der Verlag das Erscheinen an. Danke an Kollegen Natter und alle AutorInnen, die Tolles geleistet haben.


Rechtsanwälte
Recht :: Aktuell
Cumulus-Fonds: Anleger müssen nicht an innenfinanzierende Bank zahlen
Wie Sie wissen, vertreten gross::rechtsanwaelte schon seit einigen Jahren auch Anleger in verschiedene geschlossene Immobilienfonds. Die Fondsbeteiligungen wurden zu tausenden vor allem in den neunziger Jahren vertrieben. Viele der Fondsanteile wurden von den Anlegern überteuert gezeichnet. Dies führte spätestens nach Ablauf von Mietgarantieverträgen bzw. Zeitmietverträgen und einer negativen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt zu Schwierigkeiten.
Die Fonds konnten keine Ausschüttungen an die Anleger mehr vornehmen. Bei einigen Fonds konnten mit den Mieteinnahmen nicht einmal mehr die Verbindlichkeiten beglichen werden, die die Fondsgesellschaft selbst aufgenommen hatte. Dabei handelt sich insbesondere um sogenannte Innenfinanzierungen, also Darlehensverträge, die die Gesellschaft zum Erwerb bzw. der Sanierung der Fondsimmobilie abschloss.
Beim Immobilienfonds Einkaufs- und Gewerbezentrum Hettstedt GdbR wurden die Anleger zunächst außergerichtlich von der innenfinanzierenden Bank, der EuroHypo AG aufgefordert, zur Sanierung des Darlehens beizutragen. Es wurden Angebote unterbreitet, bei denen die Gesellschafter jeweils mehrere € 1.000,00 pro Gesellschaftsanteil hätten zahlen müssen. Wir haben den von uns vertretenen Anlegern empfohlen, eine solche Vereinbarung nicht abzuschließen. Dies veranlasste die EuroHypo AG schließlich, nachdem die Sanierung des Immobilienfonds gescheitert war, Klage gegen die Anleger einzureichen.
Das Landgericht Frankenthal hat nun in mehreren kürzlich ergangenen Urteilen zu Gunsten der Anleger entschieden. Es stellte fest, dass sich die EuroHypo AG an einer arglistigen Täuschung der am Fondsvertrieb beteiligten Personen und Gesellschaften beteiligte. Hintergrund ist, dass die Fondsgesellschaft die Fondsimmobilie für einen Kaufpreis in Höhe von DM 23.794.000,00 erwarb und zwar drei Tage nachdem der Verkäufer der Fondsimmobilie diese zum Preise von nur DM 18.579.000,00 erworben hatte.
Der Verkäufer der Fondsimmobilie hatte also binnen drei Tagen einen Gewinn in Höhe von fast DM 5.000.000,00 realisiert. Interessant ist das deshalb, weil die Initiatoren der Einkaufs- und Gewerbezentrum Hettstedt GdbR identisch mit dem Gesellschafter und Geschäftsführer der Verkäufergesellschaft waren. Es waren also sowohl auf Seiten des Immobilienfonds als auch auf Seiten der Verkäuferin die Herren Joseph A. Geyer und Erwin Paupers handelnde bzw. begünstigte Personen.
Das Landgericht urteilt zunächst vollkommen richtig, dass dadurch, dass diese Herren binnen drei Tagen einen um 28 % höheren Kaufpreis mit der Verkäufergesellschaft realisierten und dies im Fondsprospekt nicht eindeutig auswiesen, die Anleger getäuscht wurden. Dieser Zwischengewinn von fast DM 5.000.000,00 hätte zumindest offen gelegt werden müssen. Da dies nicht der Fall war, wurden die Anleger in die Irre geführt.
Nach Auffassung des Landgerichts hat sich die EuroHypo an dieser Täuschung beteiligt, indem sie trotz ihrer Kenntnis von diesem Zwischengewinn die Innenfinanzierung ermöglichte und damit die Durchführung der Fondskonzeption zu Lasten der Anleger erst möglich machte. Im Ergebnis müssen die Anleger nach Auffassung des Landgerichts nicht an die EuroHypo AG zahlen.
Es bleibt abzuwarten, ob die Bank gegen das Urteil Berufung eingelegt. Allen Anlegern ist zu empfehlen, Ansprüche aus der Beteiligung an Immobilienfonds genau zu prüfen. Dies unabhängig davon, ob der Immobilienfonds selbst, Banken oder andere Beteiligte Ansprüche gegen die Gesellschafter des Fonds herleiten.
Für Fragen in diesen und anderen Angelegenheiten steht Ihnen Rechtsanwalt Tino Drosdziok gern ganzen Verfügung.
Bundesgerichtshof verurteilt Deutsche Bank zur Zahlung von Schadenersatz bei Zinssatz-Swap-Geschäften
Der XI. Senat des Bundesgerichtshofes (BGH) hat am 22.03.2011 (Az. XI ZR 33/10) entschieden, dass die beratende Bank dem Bankkunden bei Empfehlung eines Zinssatz- Swap-Vertrages (hier: CMS Spread Ladder Swap-Vertrag) deutlich vor Augen hätte führen müssen, dass eine für den Kunden negative Entwicklung real ist und ihn ruinieren kann.
Der Kunde kann nach Auffassung des Bundesgerichtshofes nur dann objektiv darüber entscheiden, ob er das Geschäft wirklich abschließen will, wenn er umfassend von der Bank über die Risiken aufgeklärt wurde. Dies gilt insbesondere auch für das Risiko des Bankkunden im Vergleich zu dem der Bank. Regelmäßig haben die Banken nämlich derartige Zinssatz-SWAP-Verträge so konstruiert, dass die wesentlichen Risiken beim Kunden und eben nicht bei der Bank liegen.
Die im hiesigen Fall beklagte Deutsche Bank wurde vom BGH verpflichtet, dem Kunden allen Schaden zu ersetzen, der aus dem Zinssatz-Swap entstanden ist. Dieser bestand hier in dem Betrag, den der Bankkunde bei Auflösung des Geschäftes zu erbringen hatte.
Der BGH hat sich nicht von der Stellungnahme der Rechtsanwälte der Bank vor Urteilsverkündung beeindrucken
lassen, die erklärten, durch ein solches Urteil würde eine weitere Finanzkrise heraufbeschwört.
Diese Entscheidung klärt nun auch den Streit verschiedener Oberlandesgerichte (wir hatten über die Auffassung des OLG Stuttgart berichtet) darüber, welche Beratungspflichten die Banken bei Empfehlung von Swap-Verträgen treffen. Bei derartigen Zinswetten gehen die Pflichten der Bank regelmäßig über die Beratungspflichten bei „normalen“ Anlageprodukten hinaus. Dies galt in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall umso mehr, als der Swap-Vertrag bereits bei Abschluss des Vertrages einen für den Kunden negativen Wert in Höhe von € 80.000,00 hatte.
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes sollten Zinssatz-Swap-Verträge, die vor allem mittelständischen Unternehmen als Zinsoptimierungsgeschäfte empfohlen wurden, noch einmal genau überprüft und etwaige Schadensersatzansprüche gegen die Banken geltend gemacht werden. Als Ansprechpartner steht Ihnen Rechtsanwalt Tino Drosdziok zur Verfügung.
CGZP ist nicht tariffähig!!!
Mit Beschluss vom 14.12.2010 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) keine Tariffähigkeit für die Leiharbeitnehmerschaft zukommt. Dies hat zur Folge, dass sämtliche von der CGZP abgeschlossenen Tarifverträge rückwirkend unwirksam sind.
Mit Beschluss vom 14.12.2010 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) keine Tariffähigkeit für die Leiharbeitnehmerschaft zukommt. Dies hat zur Folge, dass sämtliche von der CGZP abgeschlossenen Tarifverträge rückwirkend unwirksam sind. Was bedeutet dies für die Leiharbeitnehmer? Regelmäßig haben die bundesweit tätigen Leiharbeitgeber mit ihren Angestellten arbeitsvertraglich die Geltung der Tarifverträge des Arbeitgeberverbandes Mittelständischer Personaldienstleister (AMP) und der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA (CGZP) vereinbart. Hierdurch sollte eine Herabsetzung der Vergütungsansprüche der beschäftigten Leiharbeitgeber erreicht werden. Denn grundsätzlich haben diese Anspruch auf die gleiche Vergütung, wie die, in den Betrieben des Entleihers, vergleichbar beschäftigten Arbeitnehmern. Von diesem Grundsatz kann nach den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes nur aufgrund eines Tarifvertrages abgewichen werden. Da allerdings das Bundesarbeitsgericht nunmehr rechtskräftig festgestellt hat, dass der CGZP keine Tariffähigkeit für die Leiharbeitnehmerschaft zukommt, genügen die von ihr abgeschlossenen Tarifverträge nicht den gesetzlichen Anforderungen für eine wirksame Abkehr vom Grundsatz des „equal pay“. Die betroffenen Leiharbeitnehmer haben deshalb (auch rückwirkend) den gesetzlichen Anspruch auf Vergütung in der Höhe, wie diese den vergleichbaren Arbeitnehmer im Betrieb des Entleihers gezahlt wird.
Wir empfehlen deshalb den betroffenen Leiharbeitnehmern diese Vergütungsansprüche schnellstmöglich gegenüber ihren Arbeitgebern geltend zu machen, um hierdurch entsprechende Verjährungs- und Ausschlussfristen zu hemmen. Sollten die Ansprüche nicht freiwillig vom Arbeitgeber ausgeglichen werden, kann erfolgreich eine Klage angestrebt werden. Die Leiharbeitgeber haben diesen Umstand mittlerweile erkannt und ergreifen erste Maßnahmen. Vielfach wurden den Angestellten neue Arbeitsverträge zu Unterzeichnung vorgelegt. Es wird der Eindruck vermittelt deren Abschluss sei nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts erforderlich. Das ist rechtlich nicht zutreffend. Mit den Änderungsverträgen wird lediglich versucht die Geltung neuer Tarifverträge zur Herabsetzung des gesetzlich gleichen Lohnanspruchs der Leiharbeitnehmer zu vereinbaren. Regelmäßig sollen die Tarifverträge des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ e.V) und den Mitgliedsgewerkschaften des DGB in Bezug genommen werden. Zwar stellen diese eine Verbesserung der Rechte der Leiharbeitnehmer im Vergleich zu den Tarifverträgen der CGZP dar, verschlechtern allerdings wiederum die derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen. Wir empfehlen daher allen betroffenen Arbeitnehmern die entsprechenden Änderungsangebote nicht anzunehmen. Hierfür besteht keine Veranlassung. Sollten Sie weitere Fragen zu den Auswirkungen der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes haben oder eine Vertretung bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche wünschen, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Tino Kroupa Rechtsanwalt